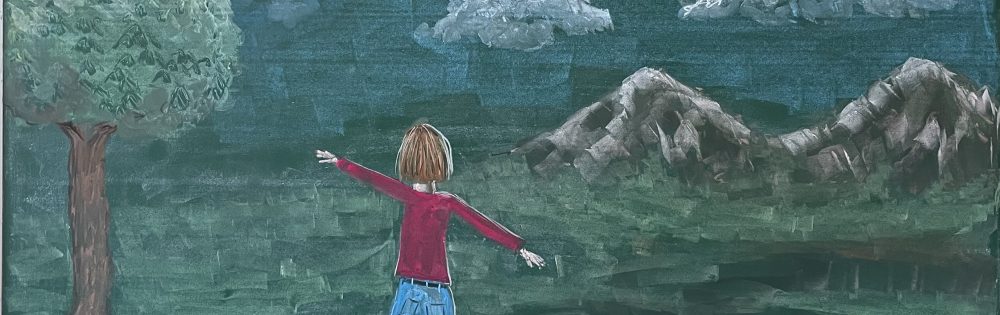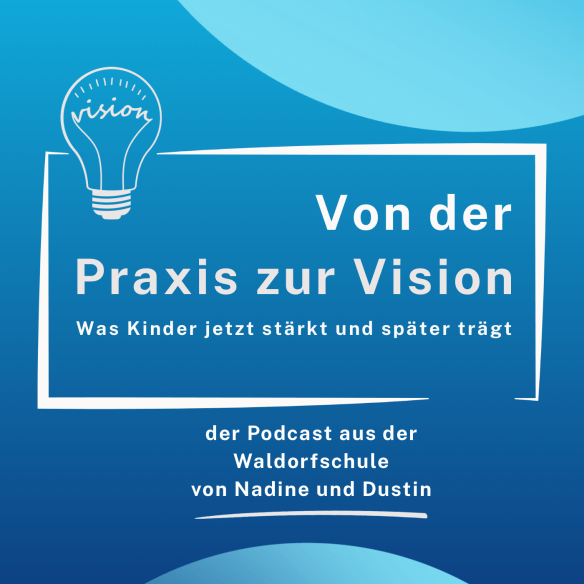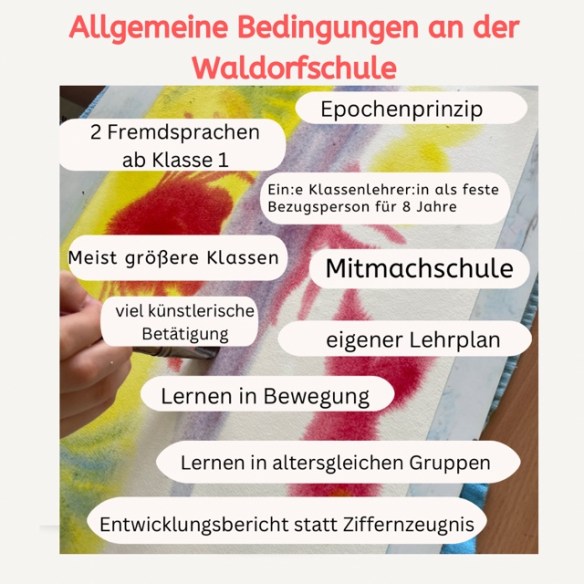Stell dir vor, die psychische Widerstandskraft deines Kindes ist wie ein Haus. Es schützt vor den Stürmen des Lebens – egal, ob es der verlorene Turnbeutel, der Streit mit der besten Freundin oder der Frust über die Hausaufgabe am Nachmittag ist. Als Eltern oder Pädagog:innen bauen wir dieses Haus nicht für unsere Kinder, sondern mit ihnen – wir reichen die Steine und entdecken gemeinsam, wie der Bau hält und trägt.
Hier sind die 7 Säulen der Resilienz (nach Reivich und Shatté), direkt übersetzt in den Alltag mit Kindern.
1. Akzeptanz: „Es ist, wie es ist“
Die Situation: Da klappt etwas nicht. Sei es eine Bastelanleitung oder die ersten Fahrversuche auf Rollschuhen. Die Resilienz-Lektion: Anstatt sofort zu sagen „Ist doch nicht schlimm“, helfen wir dem Kind zu akzeptieren: „Ja, das ist jetzt echt ärgerlich. Da klappt es etwas nicht so wie gedacht.“ Nur wer lernt, dass unangenehme Gefühle zum Leben gehören, kann sie überwinden.
2. Optimismus: „Es wird wieder gut“
Die Situation: Ein Kind traut sich nicht auf das neue Klettergerüst. Die Resilienz-Lektion: Optimismus bedeutet nicht, alles durch die rosarote Brille zu sehen, sondern die Zuversicht zu haben: „Ich habe heute noch Angst, aber ich kann es morgen nochmal probieren.“ Wir stärken den Glauben an ein positives Ende.
3. Selbstwirksamkeit: „Ich kann etwas bewirken“
Die Situation: Die Wasserflasche läuft aus. Die Resilienz-Lektion: Nicht sofort zum Wischtuch greifen! Lass das Kind es selbst erledigen. Das Gefühl „Ich kann einen Fehler korrigieren“ ist das Fundament für ein starkes Selbstwertgefühl. Und: Jedesmal, wenn du eine Aufgabe übernimmst, die dein Kind selbst erledigen könnte, vermittelst du, dass du es sowieso besser kannst.
4. Eigenverantwortung: „Ich kann es selbst steuern“
Die Situation: „Die Hausaufgaben sind blöd, ich mache die nicht!“ Die Resilienz-Lektion: Wir begleiten das Kind dabei, aus der Schuldzuweisung („doofe Schule“) herauszutreten. „Was kannst du tun, damit du heute mit deinen Aufgaben schneller fertig wirst?“ Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, macht stark.
5. Netzwerkorientierung: „Ich bin nicht allein“
Die Situation: Streit mit einem befreundeten Kind. Die Resilienz-Lektion: Resiliente Kinder wissen, wen sie (selbst!) um Hilfe bitten können. Das zeigt: Hilfe annehmen ist keine Schwäche, sondern eine soziale Superkraft. Wer ist dein „Sicherheitsteam“?
6. Lösungsorientierung: „Was machen wir jetzt?“
Die Situation: Das Lieblings-Kuscheltier ist im Urlaubsdomizil liegen geblieben. Die Resilienz-Lektion: Erstes Trauern ist okay, dann folgt der Schwenk: „Wie lösen wir das? Sollen wir dort anrufen oder darf ein Ersatz-Tier einspringen?“ Der Fokus liegt auf der Lösung, nicht auf dem Problem.
7. Zukunftsorientierung: „Was kommt als Nächstes?“
Die Situation: Das Wochenende steht vor der Tür, die Freude ist groß. Die Resilienz-Lektion: Ziele setzen und Pläne machen. Kinder lernen hier, dass sie ihre Zukunft mitgestalten können. „Was ist das Schönste, was wir am Samstag machen wollen?“
Resilienz ist kein Zustand, den man „hat“, sondern ein Muskel, den wir täglich trainieren. So ein Haus wird nicht an einem Tag fertig gebaut – aber jeder kleine Moment mit deinem Kind ist dazu geeignet, einen neuen Stein zu setzen.
Kleiner Tipp von mir: Wähle dir für die nächsten Tage eine Säule aus (z. B. die Lösungsorientierung), auf die du bewusst achtest. Wenn das nächste Mal etwas schiefgeht, frage dein Kind nicht „Warum hast du das gemacht?“ oder „Wie konnte das passieren?“, sondern „Was ist dein Plan, wie wir das lösen?“